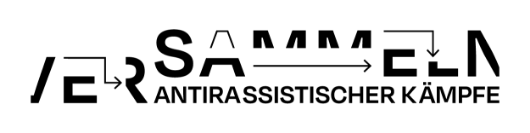Geführt von Vincent Bababoutilabo am 11.4.2022.
Auf der Schule der Freundschaft (SdF) in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, wurden zwischen 1982 und 1988 899 Kinder und Jugendliche aus Mosambik ausgebildet, unter ihnen Paulino Miguel. Mit ihm haben wir über den 40. Jahrestag der Gründung der SdF und seine Kindheit in der DDR gesprochen.
Vincent: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag in der DDR?
Paulino: Ja, sehr gut sogar. Wir sind am 13. August 1982 in Berlin Schönefeld gelandet. Ich erinnere mich an sehr freundliche Menschen, die immer gewunken haben. Ich gehörte zur ersten Gruppe von Schüler:innen. Wir waren alle in Uniformen gekleidet und ein bisschen ängstlich. Wir sind dann in ein Restaurant gegangen. Bis heute vergesse ich diesen Teil nicht, weil man dort unsere Lieblingsmalzeit serviert hatte: Broiler mit Erbsen und Kartoffeln. Dann hieß es: „Wir müssen zu den Zügen.“ Es war die erste Zugfahrt in meinem Leben.
Vincent: Was ist dir von deinem Schulalltag am meisten in Erinnerung geblieben?
Paulino: An was ich mich noch erinnere, ist, dass ich die ersten Jahre immer wieder nach Kollegen aus meiner Provinz gesucht habe, die meine Sprache sprechen. Irgendwann haben sie uns so aufgeteilt, dass es nicht mehr möglich war, die Leute zu treffen. Dann fing für mich diese Einsamkeit an. Diese Einsamkeit in der Menge. Irgendwann musste ich mich damit abfinden, dass wir unsere Sprache nicht mehr sprechen konnten. Wir mussten sie sogar verstecken.
Vincent: Warum?
Paulino: Sie haben gesagt, wir seien nur Mosambikaner. Und der Mosambikaner spricht nur Portugiesisch. [lacht] Die anderen Sprachen galten als ausgrenzend. Es hieß, wir seien tribalistisch. Wir waren zu viert in einem Zimmer, konnten kaum kommunizieren und mussten uns irgendwie mit diesem Portugiesisch durchschlagen.
Vincent: Wie habt ihr euch als Schüler:innen gegen rassistische Angriffe und Alltagsrassismus gewehrt?
Paulino: Es gab viele physische Auseinandersetzungen und wir haben uns verteidigt, wo es ging. Zur Polizei konntest du nicht gehen, es hat sie nicht interessiert. Und ich erinnere mich, später als Jugendliche haben wir uns sogar zu Schlägereien mit deutschen Jugendlichen verabredet. Einmal wurde ich eingekesselt und es kamen Kubaner zu Hilfe. Sie waren älter und durften sich meistens frei bewegen. Sie kamen und haben mich gerettet. Ja, es gab sehr viele Schlägereien, das ist nicht zu beschönigen. Leute wurden krankenhausreif geschlagen, also sowohl unsere Schüler:innen als auch die anderen.
Vincent. Wie war es bezüglich Alltagsrassismus? Habt ihr euch auch emotionalen Support geben können als Schüler:innen untereinander?
Paulino: Lange Zeit wurde geleugnet, dass es überhaupt Alltagsrassismus gab. Klar, wir haben uns auch gegen verbale Attacken gewehrt und „du Hitler“ oder „du Rassist“ oder sowas gerufen. Wir haben auch miteinander gesprochen, aber wir neigten damals dazu, den Rassismus durch Witze zu übertönen. Und das erlebe ich bis heute. Aber so richtig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu trauern, gab es gar nicht. Hinterher war man oft allein. Ich habe mir oftmals gesagt: „Wo bin ich hier gelandet?“ Viele meiner Kolleg:innen sind heute vereinsamt. Wir konnten die gemachten Erfahrungen lange nicht aufarbeiten, weil wir keine Unterstützung bekommen haben. Es hat jemand gefehlt, der sich dieser Thematik angenommen hat.
Vincent: Carlos Conceição, ein Schüler der SdF, wurde in der Nacht vom 19. auf 20. September umgebracht, von Jugendlichen aus Staßfurt. Wie habt ihr als Schüler:innen darauf reagiert?
Paulino: Wir waren sehr wütend. Es war dann für jeden klar: Das, was wir erlebt haben, das war wirklich Rassismus. Hass. Wir haben versucht, es den Verantwortlichen zu erklären, aber sie haben es nicht ernst genommen. Wir wussten, dass es immer wieder passieren kann. Unsere Wut und unsere Trauer wurden dann völlig falsch interpretiert. Man unterstellte uns, dass wir Rache üben wollten. In Staßfurt gab es die entsprechenden Gerüchte, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt längst Freund:innen vor Ort hatten. Ich habe mit vielen bis heute Kontakt, aber damals war die Stimmung katastrophal. Ich werde es nie vergessen. Im An- und Verkauf stand ein ganz verängstigtes Mädchen und sagte zu mir: „Bitte bring mich nicht um!“ Ich schaute zu den Erwachsenen, aber die sagten nichts. Uns wurde unterstellt, dass wir wegen Carlos mehrere Deutsche umbringen wollen. Aber ehrlich gesagt waren wir nicht einmal in der Lage, so etwas überhaupt zu sagen. Wir hatten einfach Angst. Aber ich sage es trotzdem immer wieder: Wir Kinder aus Mosambik haben den Zaun zwischen uns und den anderen nicht gebaut, die Staßfurter Bevölkerung auch nicht. Das war die SED-Regierung mit ihrem „Bruderstaat“. Sie betrogen uns um unsere Kindheit und unsere Beziehungen zu den Staßfurter:innen. Das möchten wir gerne nachholen.
Vincent: Der Kontakt zur DDR-Bevölkerung war stark kontrolliert. Die Treffen waren offiziell und formalisiert, alles ganz im Sinne des Staatssozialismus, und alle waren immer Vertreter des mosambikanischen Volkes und nie einfach nur Kinder. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, Freunde außerhalb der Schule zu finden?
Paulino: Wenn du Spaß haben und Freunde finden wolltest, dann musstest du was Illegales machen. Unser Alltag war komplett durchdekliniert. Wir hatten zum Beispiel eine Ausgangskarte. Die mussten wir mitnehmen, wenn wir gegangen sind, und aufhängen, wenn wir gekommen sind. Wir sind rein in die Schule, ganz pünktlich, haben die Karte aufgehängt, und dann sind wir über den Zaun wieder in die Stadt. Da haben wir dann unsere Freunde getroffen, die mit uns ins Fußballstadion und in die Kneipe gegangen sind. Oder Liebschaften gefunden. Das war genau diese Zeit. Draußen gab es auch Mädels oder Jungs, die warteten schon mit Bier am Zaun. Ja, und das Schönste dabei war, keiner hat den anderen verraten. Ich gehörte sowieso zu denen, die immer abgehauen sind.
Vincent: Und Du hast auch heute noch Kontakt zu den Deutschen, die du da kennengelernt hast?
Paulino: Ja, mit manchen bin ich bis heute befreundet. Andere drehen sich jetzt um, wenn sie mich sehen. Die sind vielleicht in irgendwelchen Parteien oder haben eine bestimmte Gesinnung. Als Kinder sind wir zu Feiertagen und an manchen Wochenenden bei deutschen Familien untergebracht worden. Ich hatte großes Glück mit meiner Familie und wir sind bis heute befreundet. Vater und Mutter sind bereits verstorben. Ich war auf beiden Beerdigungen.
Vincent: Was wünschst du dir zum 40. Jubiläum der Gründung der Schule der Freundschaft?
Paulino: Mein wichtigstes Anliegendes ist Folgendes: Ich bin kein Projekt. Oft interviewen uns Leute – und dann? Was passiert dann? Danach sind wir immer noch in der gleichen Situation wie vorher. Manche von uns haben ihre Familien nie wiedergefunden, viele sind traumatisiert oder vereinsamt. Ein Kollege von damals ist in der Psychiatrie und sagte zu mir: „Jetzt weiß ich wie sich Einsamkeit anfühlt. Ich bin hier im Krankenhaus und niemand besucht mich.“ Wir haben nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Gegenwart. Einige leben in prekären Situationen, andere haben Karrieren gemacht. Sind Beamte, Ärzte, Lehrer. Ich möchte, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, was unsere Vergangenheit war, wer wir heute sind und wie unsere Zukunft aussehen könnte. Mein Ziel ist es, dieses Jubiläum groß zu machen. Es ist wichtig, dass wir uns feiern. Niemand hat sich aufgegeben, wir können noch lachen, wir haben Familien, wir sind Menschen. Keine Projekte. Die interessanten Fragen für mich sind: Wie können wir unsere Geschichte wieder aufnehmen? Wie können wir unsere Geschichte schreiben und unseren Kindern weitergeben? Fest steht: Wir wollen unsere eigene Geschichte in die Hand nehmen. Auch wenn wir keine Mittel bekommen. Diesmal lassen wir uns nicht hin- und herschieben. Wir haben nie gelernt, uns zu äußern. Jetzt wollen wir unsere Geschichte schreiben.
Eine Kurzfassung des Interviews ist in einer Sonderbeilage für die taz erschienen am 18.05.2022. Das PDF zur taz-Sonderbeilage kann <hier> heruntergeladen werden.