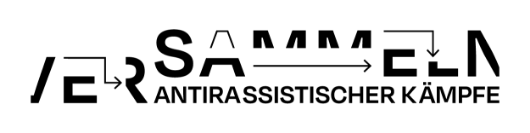Die Fragen stellte Efthimia Panagiotidis
In den 1980er- und 1990er-Jahren organisieren sich Migrantinnen, schaffen Räume durch selbstorganisierte Kongresse, suchen nach Vernetzung und den Dialog mit Feministinnen der Mehrheitsgesellschaft. Sie nutzen Frauenwochen in Berlin, Bremen und anderswo, um ihre Themen einzubringen und sich mit ihren Anliegen sichtbar und hörbar zu machen.
Efthimia: In der „Dokumentation des 1. Gemeinsamen Kongresses ausländischer und deutscher Frauen“ 1984 wurde darüber berichtet, dass das Begehren nach der Suche und der Austausch über Gemeinsamkeiten zwischen „deutschen“ und „ausländischen“ Frauen durch die Migrantinnen torpediert wurden (vgl. Ruf, Anja (1984): „Was haben ausländische und deutsche Frauen gemeinsam“).
Wenn Du an die Zeit zurückdenkst, wie hast Du die Begegnung und den Austausch zwischen Mehrheitsangehörigen und Frauen mit Migrationserfahrung erlebt? Welche (Konflikt‑)Themen standen zu der Zeit im Fokus?
Annita: Es waren mindestens zwei Ebenen, die große Spannungen erzeugten: die Frage, wie wir miteinander ins Gespräch kommen können, und zu welchen Themen. Zu dem „Wie“ gehörte die manchmal offen formulierte und in der Regel implizite Erwartung, die „ausländischen Frauen“ würden den „deutschen Frauen“ erklären, welche Probleme sie hätten, und sie auf freundliche Art auf ihr Unwissen und ggf. auf ihren „internalisierten Rassismus“ hinweisen.
In meinem Erleben war dies eine klassische Doublebind-Konstruktion: Ließen sich „ausländische Frauen“ auf diese Erwartungen ein – und das taten sie zumindest für eine Weile –, dann verschob sich der Fokus der Debatte oft auf die Kritik, dass „ausländische“ Frauen zu konfrontativ und wütend wären, ihre Anliegen zu emotional vorgebracht hätten, sodass dies deutsche Feministinnen vor den Kopf stoßen und das Lernen verhindern würde. Also hatten wir die Debatte, wie pädagogisch von Rassismus Betroffene ihre Kritik äußern dürfen oder auch müssten. Migrantinnen wurden für die Beseitigung der Schuldgefühle deutscher Frauen für zuständig erklärt, während sie wiederum, von Audre Lorde inspiriert, dabei waren, den „Nutzen ihres Ärgers“ zu erkennen.
Spannend daran fand ich den toten Winkel in dieser Art von Auseinandersetzung. Denn die Empörung und Enttäuschung äußerten oft feministische Frauen, die sich selbst darüber aufgeregt hatten, dass an sie von Männern ähnliche Ansprüche gestellt wurden.
Frauenbewegungen in Deutschland, in ihrer Zusammensetzung „mehrheitsdeutsch“ und mittelschichtsgeprägt, beschäftigen sich zu der Zeit kaum mit existenziellen Fragen, die Migrantinnen betreffen: das Recht zu bleiben, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht oder den Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt zu erkämpfen, einen Umgang mit Erfahrungen von subtilen und offenen Ausgrenzungen, Marginalisierung und Rassismus zu finden.
Efthimia: In dem auf ein solidarisches Miteinander ausgerichteten Aushandlungsraum treten die Beteiligten in zwei Staatszugehörigkeitsgruppen, in der Gegenüberstellung der „deutschen“ und dem homogenierten Anteil der „ausländischen“ Frauen, auf. Magst Du vielleicht näher auf die Bezeichnungspolitiken eingehen, sie historisch bzw. politisch in die Zeit der 1980er oder früher kontextualisieren?
Annita: „Ausländische Frauen“ bzw. „ausländische Feministinnen“ und „deutsche Frauen“ oder „deutsche Feministinnen“ waren gängige Begriffe der Zeit, die ich hier im Rückblick auf diese Phase auch so benutze und die aus heutiger Sicht undifferenziert klingen mögen. Es waren Versuche, Macht- und Statusdifferenzen zu markieren bzw. vermeintliche Egalität oder Harmonisierungstendenzen durch eine Subsumierung unter den Begriff „Frauen“ oder „Feministinnen“ aufzubrechen.
Mehrheitsdeutsche Frauen wehrten sich gegen ihre Subsumierung unter der Kategorie „deutsche Frauen“, verlangten differenziert und als Subjekte wahrgenommen zu werden, auch wenn sie zugleich die Kategorie „ausländische Frauen“ hinreichend und normal fanden, um diejenigen zu erfassen, die „nicht von hier“ seien.
Insofern gibt und gab es „die deutschen“ und „die ausländischen Frauen“ nicht, und zugleich gab bzw. gibt es sie doch als zwar unscharfe, aber nicht zu übergehende analytische Kategorien, um unterschiedliche Machtpositionen zu thematisieren. Sie gab es dort, auf diesen Kongressen und in den damaligen Quotierungsdebatten, und es gibt diese definierten Kollektive im Kontext von Gleichstellungspolitiken und Empowermentstrategien auch heute, wenn auch inzwischen unter anderen Begrifflichkeiten.
Neben der Fremd- und Selbstbezeichnung „ausländische Frauen“ bzw. „ausländische Feministinnen“ waren aber auch schon die Begriffe „Migrantinnen“, „Einwanderer“ bzw. „Einwanderinnen“ im Umlauf. Die offizielle Politik der 1980er-Jahre und noch sehr lange auch in der Zeit danach orientierte sich am Diktum „Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland“, weshalb der Begriff „Einwander_innen“ ein widerständiger Begriff war. Er stellte eine Möglichkeit dar, die Tatsache der Einwanderung sichtbar zu machen, mit Forderungen nach gleichen Rechten zu verknüpfen und sich dabei aktiv in politische Diskurse einzumischen.
Dieses Selbstverständnis als Nicht-Einwanderungsland, bezeichnet als die konsensuale, parteiübergreifende politische Lebenslüge der BRD, veränderte sich nur sehr langsam. Ich würde sagen, dass erst die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 ein ernsthaftes Zeichen in Richtung Veränderung war. Später folgte die Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes, das am 1.1.2005 in Kraft getreten ist. Eigentlich sah dieses Gesetz eine Begrenzung der Zuwanderung vor, war dennoch mit Regelung des Aufenthalts und Integrationsmaßnahmen für diejenigen verbunden, die schon länger hier waren und (vorwiegend aus staatlichen arbeitsmarktpolitischen Interessen) nun auch hierbleiben sollten.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dieser erste Kongress von 1984 in Frankfurt in einer Zeit stattfand, in der diskursiv und rechtlich eine „Rausschmisspolitik“ vorherrschte, ist es nicht verwunderlich, wenn sich Migrant_innen als „Ausländer_in“ bezeichneten und sich als hier nicht erwünscht erlebten. Begriffe wie „Schwemme“, „Flut“, „Ströme“, eine Rhetorik der „drohenden Überfremdung“ waren normal. Beispielhaft erinnere ich mich an Debatten über das sog. Zimmermann-Papier aus der Feder des damaligen Innenministers. In diesem wurde die Senkung des Nachzugsalters und damit die schnellere zeitliche Begrenzung für das Nachholen von Kindern gefordert, die in den Herkunftsländern zurückgelassen worden waren, oder von sog. „Pendelkindern“ von „Gastarbeiter_innen“. Auch wenn dieses Gesetz an der mitregierenden FDP damals scheiterte, hatte die Debatte ihre Wirkung entfaltet. Im Übrigen war dies auch eines der wichtigen Themen für ausländische Mütter, das im Horizont deutscher Feministinnen konsequent ausgeblendet wurde. Auch die politische Diskussion um sog. „Rückkehrprämien“ und eine unerträgliche Rechtsunsicherheit durch befristete Aufenthaltserlaubnisse, die jede langfristige Lebensplanung untergrub, animierte gerade nicht dazu, sich als zugehörig zu dieser Gesellschaft zu fühlen und zu definieren.
Im Jahr 1983, am 30. August, sprang Cemal Kemal Altun aus dem sechsten Stock des Verwaltungsgerichts in Berlin, um der ihm drohenden Auslieferung an die türkische Militärdiktatur zu entkommen. Sein Tod war ein einschneidendes Erlebnis für viele migrantische Communitys. Wie wir später im Laufe der Jahre mitbekommen mussten, war er nicht der Letzte, der sich das Leben genommen hat. Aber Altuns Tod war der erste, der in den Medien breite Öffentlichkeit fand und zu großen Protesten gegen die deutsche Abschiebepolitik führte.
Bedrohlich wirkte auch die Veröffentlichung des Heidelberger Manifests vom 17. Juni 1981, mit dem 15 deutsche Hochschulprofessoren vor der „Unterwanderung des deutschen Volkes“ und der „Überfremdung“ der deutschen Sprache, der Kultur und des „Volkstums“ warnten und dem offenen Rassismus eine vermeintlich wissenschaftliche Legitimation verliehen.
Die großen politischen Fragen der Zeit wie der NATO-Doppelbeschluss und die Formierung einer neuen starken Friedensbewegung gegen die Nachrüstung, auch der Beginn der Abrüstung und die sich abzeichnende Perspektive der Überwindung des kalten Krieges waren auch in migrantischen Communitys sehr präsent. An den Friedensdemos und Protestaktionen nahmen viele Migrant_innen teil. Nicht zuletzt kamen viele aus Ländern, die von Kriegen, Bürgerkriegen und Diktaturen bzw. deren Folgen gezeichnet waren. Und Migrationsbewegungen sind ja nicht nur in Verbindung mit, aber nie unabhängig von solchen politischen Verhältnissen zu verstehen.
Diese kursorische Aufzählung aus meiner Erinnerung ist sicher lückenhaft und soll hier nur als Schlaglicht auf die Ausländerpolitik und das politische Klima der 1980er-Jahre dienen, die uns als Migrant_innen und feministische Antirassistinnen erschüttert und auf unterschiedliche Weise politisiert haben. Dadurch wird vielleicht auch deutlich, warum es zum einen feministische Kämpfe waren, zugleich aber auch antirassistische Kämpfe, die nicht getrennt von der Männerwelt stattfanden. In Bezug auf viele der hier genannten essenziellen Themen waren es und sind es teilweise immer noch Kämpfe, die auch mit Männern und teilweise sogar mit und in männerdominierten politischen Gruppen stattfanden.
Weitere Begriffe, wie die Selbstbezeichnung „Migrantinnen“, waren auch damals schon geläufig und kamen dann in den 1990ern verstärkt in die Debatte. Später, Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre kam der Begriff „Schwarze Frauen“ als Angebot und Möglichkeit einer Selbstbezeichnung aller Frauen mit Rassismuserfahrungen auf. Dagegen erhob sich aber auch Widerspruch.
Die Auseinandersetzung über geeignete Selbstbezeichnungen und die Suche nach Dachbegriffen, die, wenn nicht alle, dann doch möglichst viele Frauen erfassen könnten, haben im Prinzip nie aufgehört und bleiben ein umkämpftes Terrain.
Efthimia: Was entwickelte sich aus den Konflikten in den 1980er-Jahren? Du erwähnst die Selbstbezeichnung „Schwarze Frauen“ als Identifizierungsraum für Frauen mit Rassismuserfahrungen. In Bezug auf die Annahme dieser kollektiven Identität erinnere ich mich an meine migrantische Frauenlesegruppe Mitte der 1990er-Jahre, in der wir Frauen – die in den griechischen und türkischen „Gastarbeiter“-Communitys in Hamburg sozialisiert waren – uns unter der politischen Kategorie „schwarze Frauen“ subsumiert und uns mit dem Verhältnis von Rassismus und Sexismus anhand von Texten Schwarzer Feministinnen auseinandergesetzt haben. Diese Bezeichnung war aber kein Konsens in den migrantischen Gruppen. Was waren zu dieser Zeit wichtige Debatten in Fragen von Selbstbezeichnung?
Annita: Literatur von Schwarzen Frauen war in migrantisch-feministischen Zusammenhängen sehr wichtig, vor allem von Audre Lorde, die sich zwischen 1984 und 1992 länger in Berlin aufhielt und mit ihrer Arbeit eine sehr wichtige Inspiration für Schwarze und migrantische Frauenbewegungen war, und bell hooks, die sehr wohltuend auch auf die Dimension „Klasse“ bestand. Und auch das Buch „Farbe bekennen – Afro-Deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte“ ist als das erste von Schwarzen Frauen in Deutschland eine wichtige Publikation gewesen.
In der Tat war die Subsumierung unter dem Begriff „Schwarze Frauen“ umstritten. So haben z. B. Frauen aus türkischen und kurdischen Communitys dagegen eingewandt, sie seien Migrantinnen und nicht Schwarz. Auch Frauen aus anderen ehemaligen Anwerbeländern und ihre Nachkommen fanden sich unter dieser Benennung nicht wieder. Vielmehr hat sich für eine Weile eine Aufzählung verschiedener Gruppen durchgesetzt.
Eine Konsequenz der Auseinandersetzungen der 1980er-Jahre, auf die ich vorhin eingegangen bin, war, dass die feministisch-antirassistischen Kongresse in den 1990er-Jahren keine gemeinsamen von „ausländischen und deutschen Frauen“ mehr waren. Für den Kongress von 1990 wurde die Bezeichnung für „Ethnische Minderheiten und Afro-Deutsche Frauen“ gewählt, ein vorläufiges Ergebnis des damaligen Diskussionsprozesses. Ab 1991 hieß es dann „Kongress von und für Immigrantinnen, Schwarze deutsche, jüdische und im Exil lebende Frauen“.
Die passende Namensgebung für unsere Bewegungen war eine zentrale politische Frage. Eine Bezeichnung zu finden, in der sich alle von Rassismus betroffenen Frauen wiederfinden könnten, die alle unsere Erfahrungen und Standorte umfasst, war ein unmögliches Unterfangen. Der vorgeschlagene Begriff „Schwarz“ würde Unterschiede unsichtbar machen und wurde von vielen nicht geteilt, dafür waren die Frauen und ihre Zugehörigkeiten zu heterogen. Außerdem würde die Suche nach einem Einheitsbegriff der Logik der Dominanzgesellschaft folgen, die alle unter dem Label „Ausländerin“ subsumierte. Um möglichst viele unserer maßgeblichen Unterschiede sichtbar zu machen, wurde für die weiteren Kongresse die explizite Benennung der zu dieser Zeit aktiven und adressierten Gruppen gewählt. Das entsprach dem Selbstverständnis der meisten Teilnehmerinnen und schien für die Zeit der passende Weg zu sein.[i] Denn zu unterschiedlich und ungleichzeitig waren und sind die Ausgangs- und Lebensbedingungen der migrierten Einzelnen und der Gruppen, denen sie sich jeweils zugehörig fühlten, zu unterschiedlich auch die Migrationsgründe und –wege und nicht zuletzt der rechtliche Status der von den unterschiedlichen Formen von Rassismus Betroffenen. Und diese Unterschiede im Zusammenhang mit den politischen Konjunkturen können Möglichkeiten des Solidarisierens aber zugleich der Spaltung bieten.
Bedeutend für die Findung des eigenen politischen Standortes war für viele Migrantinnen, auch für mich, die Intervention von FeMigra, einer Gruppe Feministischer Migrantinnen aus Frankfurt/Main, durch einen für die Bewegung wichtigen Text, der im Jahr 1994 erschien. Im Text „Wir, die Seiltänzerinnen – Politische Strategien von Migrantinnen gegen Ethnisierung und Assimilation“ stellen sie Erkenntnisse ihres internen Diskussionsprozesses dar, der im Kontext des Immigrantinnen-, Frauen im Exil-, jüdische Frauen- und Schwarze Frauen-Kongresses in Bonn im März 1994 stand. Sie wägen ab, welche Problematiken die jeweiligen Selbstbezeichnungen in sich bergen, und entscheiden sich für die Bestimmung einer eigenen politischen Identität als Migrantinnen. Es war ihnen wichtig, über die Position, die sie einnehmen, die Einwanderungsgeschichte und ‑politik dieses Landes in den Mittelpunkt zu rücken. Diese Position brachte auf den Punkt, was wir ähnlich auch in Hamburger Gruppen von Migrantinnen diskutiert haben, und ist heute aus meiner Sicht weiterhin aktuell.
In dem Text „Seiltänzerinnen“ lässt uns die Gruppe FeMigra an weiteren Gedankengängen teilhaben: Bis zu diesem Zeitpunkt hätten sich die meisten als Schwarze Frauen verstanden, das heißt als Frauen, die nicht nur Sexismus, Unterdrückung, Ausbeutung und Ausgrenzung erfahren, sondern auch rassistische Praktiken. Während des Kongresses wäre ihnen klar geworden, dass die Kategorie Schwarz ihre spezifischen Erfahrungen nicht fassen könne. Denn zum einen wäre ihre Hautfarbe nicht Schwarz und zum anderen würde diese Kategorie den Grund für ihre Anwesenheit in Deutschland nicht zum Ausdruck bringen. Der Begriff Migrantin dagegen kennzeichnet den Schritt der Immigration, den zum Teil die Eltern oder auch sie selbst machten, vor allem aber unterstreicht er die politisch-soziale Komponente des Vergesellschaftungsprozesses. Am Beispiel der Migration wird die Funktion des Rassismus in der nationalen und internationalen Arbeitsteilung deutlich.[ii]
Wie wir wissen, sind Selbstpositionierungen wie auch Fremddefinitionen nichts Statisches. Sie waren und bleiben aus guten Gründen ein umkämpftes Terrain. Jede Generation und die neuen Bewegungen, die entstehen, kommen nicht drum herum, sich damit zu befassen.
Efthimia: Du weist auf die Relevanz der Einwanderungsgeschichte und ‑politik hin, die auch in Hamburger Migrantinnenkreisen diskutiert wurde, und, dass dieser Fokus auch heute im Blick zu behalten ist. Magst Du zu den Themen der 1990er-Jahre etwas sagen bzw. Aspekte spezifizieren? Was waren für Dich wichtige Stationen?
Annita: Die 1990er-Jahre erinnere ich als die Zeit der vermehrten rassistischen Anschläge in Ost und West und des „Asylkompromisses“ 1993. Migrantische und Schwarze Bewegungen hatten die Nachwendezeit zu verarbeiten, die lebensbedrohlich wirkte und es auch für viele wurde. Auch viele derjenigen, die angefangen hatten, sich hier zu etablieren, begannen erneut daran zu zweifeln, ob sie hier eine Perspektive hätten. In meinem Umfeld sind einige sogar ausgewandert, meistens weitergewandert in Richtung USA und Kanada. Ich erinnere mich an die Zeit als eine bedrohliche, aber auch eine sehr kämpferische Zeit mit viel Trauer, aber auch vielen Aktionen und Solidarisierungsmomenten.
Es gab aber auch andere Aspekte, auf die ich zurückblicke, wie z. B., dass sich in der Zeit Frauenprojekte schrittweise etablierten, auch solche für und mit Migrantinnen. Dabei wurden Streit und Kontroversen über die Besetzung von Arbeitsplätzen in der Projektlandschaft und über die Frage von professionellen Kompetenzen für diese Arbeit lauter. Wer kann/soll/darf wen beraten und begleiten? Wieso fühlen sich deutsche Feministinnen berufen, emanzipatorisch mit Migrantinnen zu arbeiten, während Migrantinnen als emotional verwickelt und betroffen galten? Ich erinnere mich an viele Auseinandersetzungen in Begegnungsstätten und Frauenberatungsstellen in Hamburg und auch über Quotierungsdebatten, die mehr oder weniger erfolgreich verliefen.
In den 1990er-Jahren war ich oft bei den Frauenwochen in Bremen. Ich konnte verfolgen, wie sich die Themen sukzessive verschoben haben, Rassismus, Kolonialismus und die Folgen, internationale Arbeitsteilung, Geschlechterverhältnisse unter Migrationsbedingungen und vieles mehr nahmen einen prominenten Platz ein. Auch an dem jeweiligen Motto, wie z. B. „Frauen zwischen Grenzen“[iii] oder „Rassismus/Sexismus – Frauen und Fremde“, war zu merken, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Themen lag. Intersektionale Perspektiven kamen mehr in den Blick, und Migrantinnen und Schwarze Frauen haben zunehmend als Mitorganisierende ihre Themen gesetzt. Es etablierte sich zunehmend, auch getrennte Räume im Rahmen der Frauenwochen zu schaffen, in denen Migrantinnen, Frauen mit Rassismuserfahrungen sich treffen, austauschen und bilden konnten. Das waren Zugänge, die das Gemeinsame und das Getrennte unter einen Hut bringen wollten.
In beiden Formaten erinnere ich mich in erster Linie an Streit und Anstrengung, aber auch teilweise an produktive Diskussionen. In den getrennten Räumen, die man heute unter „safer spaces“ fassen würde, gab es Streit nach innen. Durch das Fehlen der direkten Konfrontation mit mehrheitsdeutschen Frauen konnte in diesen Settings über das Trennende zwischen den verschiedenen Frauen gesprochen werden, unterschiedliche individuelle und kollektive Strategien wurden wahrnehmbar, und für mich konnten auch die politischen Differenzen, die es durchaus gab, deutlicher werden. Diese wurden meistens in den gemeinsamen Auseinandersetzungen verdeckt, weil andere Fronten in den Vordergrund rückten. Das zeigte sich bei den Frauenwochen manchmal innerhalb ein und desselben Tages. In den gemeinsamen Räumen kam es schnell zu einem deutsch-ausländischen Gegensatz. Es gab eben viele unterschiedliche Verbindungs-, aber auch Trennungslinien, und die Vorträge und Workshops haben trotz der Anstrengung dazu beigetragen, sie genauer auszuloten.
Mich hat die Idee geleitet, die antirassistische Perspektive in das Projekt der Frauenbefreiung zu integrieren. Deshalb habe ich immer wieder zusammen mit anderen Mitstreiterinnen Anläufe gemacht, mich in gemischte Frauenzusammenhänge einzubringen und den Dialog zu suchen. Ich muss an einen Konflikt im Rahmen der Frauenwoche in Bremen Anfang der 1990er-Jahre denken, den ich exemplarisch kurz skizzieren möchte.
In einer Veranstaltung unter dem Titel „Rassismus als Thema für Feministinnen“ kamen wir auf die Frage der rechtlichen Gleichstellung von Einwander_innen als eine wichtige Forderung und eine der Voraussetzungen, um das Projekt der Veränderung dieser Gesellschaft unter zumindest formal gleichberechtigten Bedingungen gemeinsam anzugehen. Das war eine Forderung dieser Zeit, die aus migrantischer Perspektive zentral war. Sie stieß auf Widerspruch mit dem Argument, Feministinnen sollten und dürften durch die Unterstützung solcher Forderungen nicht zur Verfestigung des aufenthaltsrechtlichen Status von „türkischen Machos“ beitragen. Denn „solche Männer“ würden dann ihre Frauen aus einer besseren Position heraus unterdrücken können. Zum Schutz von Migrantinnen wäre die Abschiebung „gewalttätiger Migranten“ ein legitimes Mittel, das „türkische Patriarchat“ dürfe auf keinen Fall gestärkt werden. Diese Position war in dieser Gruppe nicht marginal, sondern wurde tatsächlich von mehreren engagiert vertreten und argumentativ gestützt. Es wurden weitere Argumente beigesteuert, die in die Richtung gingen, dass der Pass nicht wichtig wäre, „Frauen hätten keine Nationalität und kein Vaterland“. Wenn ich das so erzähle, kommt es mir selbst irreal und zu plakativ vor, um wahr zu sein. Die Empörung der anwesenden Migrantinnen wurde jedenfalls laut geäußert. Bei einem Teil der mehrheitsdeutschen Teilnehmerinnen gab es Betroffenheit und betretenes Schweigen. Es war schwer, in dieser Dynamik einzuschätzen, ob dieses Schweigen als Loyalität, Nachdenklichkeit, Hilflosigkeit oder Zustimmung zu den vertretenen Positionen zu deuten wäre.
Für viele der teilnehmenden Migrantinnen war es erneut ein Tiefpunkt in der Auseinandersetzung mit mehrheitsdeutschen Feministinnen. Wer sind denn die Verbündeten, auf wen können wir uns überhaupt verlassen? Das waren Fragen, die in der Nachbereitung aufkamen. Das Thema häusliche Gewalt, das uns auch in migrantischen Zusammenhängen intensiv beschäftigt hatte und in Frauenberatungsstellen bearbeitet wurde, war gar nicht so einfach mit mehrheitsdeutschen Feministinnen im Sinne der betroffenen Frauen und in Anerkennung ihrer auch rechtlich begrenzten Handlungsmöglichkeiten solidarisch und fachlich angemessen zu verhandeln.
Die Themen begleiten uns ja auch heute weiter. Dass Kämpfe gegen Sexismus sich des Rassismus bedienen und das eigene Verstricktsein in patriarchale Verhältnisse dabei relativiert wird, hatten wir auch in den Auseinandersetzungen über die „Silvesternacht“ in Köln. Dabei wissen wir alle inzwischen mehr über Intersektionalität.
Auch hier nur Schlaglichter und Stimmungen der Zeit. Vieles ist systematischer erfasst und in der Publikation „Migrantischer Feminismus“ nachzulesen.[iv] Eine Arbeit, für die ich dankbar bin, und wovon es viel mehr braucht.
Efthimia: In der Politik von rechtlicher Gleichstellung tauchen unterschiedliche Positionen auf, welche eine gemeinsame Praxis unter Verbündeten nach wie vor herausfordern können, in dem Sinne, dass die Beteiligten in ihre partikularen Identifizierungsräume treten, um die eigenen Forderungen zu markieren. Wie würdest Du das Thema der Identitätspolitiken heute im Antirassismus beschreiben? Wie können wir damit weiterdenken für die Dominanzverhältnisse im Antirassismus aktuell?
Annita: Aktuell sind neben Schwarz auch Bezeichnungen wie People of Color (PoC), Women of Color (WoC), Black Indigenous People of Color (BIPoC), in bestimmten Kreisen verbreitet. Sie gelten als politische Selbstbezeichnungen. Man kann sicherlich darüber streiten, welche Vorteile und Nebenwirkungen sie für wen haben. Denn sie sind inklusiv und exkludierend zugleich. Der Weg der Benennung möglichst vieler rassifizierter Gruppen spiegelt sich zwar hier wider, lässt aber hierarchisierende Züge und Auswirkungen erkennen und nimmt einige Gruppen, die wie oben beschrieben in den 1990er-Jahren explizit genannt wurden (z. B. jüdische Frauen, Migrantinnen), nicht mehr in den Blick. Geflüchtete kommen auch nicht explizit vor. Rom*nja und Sinti*zze kommen manchmal in Aufzählungen vor, oft aber nicht. Wer unter den o. g. Sammelbegriffen gemeint ist und sich gemeint fühlt, bleibt oft unklar und heikel.
Ich teile die Irritation über manche Bezeichnungen, die aus den USA importiert zu sein scheinen, ohne dass sie ihre Entsprechung im deutschen Kontext so richtig finden könnten. Wer wird z. B. unter „Indigenous“ adressiert und wer versteht sich darunter? Diese Frage höre ich oft und stelle sie auch selbst, sie wird aber nicht sehr laut und öffentlich gestellt, weil solchen Debatten immer eine Instrumentalisierung durch die ‚falsche Seite‘ droht. Auch mit der Perspektive, die u. a. Kien Nghi Ha in die Diskussion eingebracht hat, dass der BIPoC-Begriff nicht als inklusiv, sondern als hierarchisch und exklusiv ausgerichtet gelesen werden kann, müssten wir uns intensiver beschäftigen. Ich teile die Sorge, dass durch das Hervorheben von bestimmten historischen Gruppenerfahrungen als „besonders“ eine Wertigkeit und Rangfolge rassistisch unterdrückter Communitys nahegelegt werden könnte und eine darauf aufbauende Politik, die auf der Basis von Opferhierarchien operiert, unproduktiv, normativ und politisch nicht zu verteidigen und nicht mit emanzipatorischen Vorstellungen vereinbar wäre.[v]
War in den 1990er-Jahren der Impuls, Menschen mit Rassismuserfahrungen unter dem Begriff „Schwarz“ zu subsumieren und auf diese Weise inklusive Benennungen zu finden, ist es ironischerweise heute andersherum: Die Bezeichnung „Schwarz“ wird enger gefasst und legt oft den Eindruck nahe, dass Schwarz in erster Linie doch Hautfarbe meint, trotz Beteuerungen, Schwarz und weiß seien als soziale Konstruktionen bzw. soziale Positionierungen zu verstehen.
Nicht selten werden die Begriffe übernommen, weil sie en vogue sind und man zur Gemeinschaft gehören will. Das will ich gar nicht kritisieren, es gehört zu den Suchbewegungen der Einzelnen. Es ist aber schwer zu ertragen, wenn andere zu wissen meinen, wie man sich selbst ‚richtig‘ zu positionieren hätte bzw. fremdpositioniert wird.
Sind in den aktuell benutzten Bezeichnungen Geflüchtete und ehemalige „Gastarbeiter_innen“ unter PoC subsumiert? Migrant_innen finden sich je nach Migrationsgeschichte, Auswanderungsland oder auch Generation unter dem Begriff PoC wieder, während andere nichts mit der Bezeichnung PoC anfangen können. Das ist nicht weiter beunruhigend, weil wir nicht von homogenen Großkollektiven ausgehen. Beunruhigend ist allerdings, dass viele Migrant_innengruppen in den Diskursen oft nicht als Menschen mit Rassismuserfahrungen angesehen werden.
Dabei entspricht es weder der Selbstpositionierung vieler Migrant_innen noch den politischen Realitäten, wenn man an die Kontinuität von Pogromen und Morden an als Migrant_innen bzw. als ausländisch identifizierten Menschen denkt: Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen, die NSU-Morde 2000–2007 bis hin zu den Anschlägen in Halle und Hanau, die noch sehr frisch sind, und den vielen weiteren, weniger medial präsenten, aber tödlichen Gewalttaten. Die reale Gefahr, dass man aufgrund des vermeintlich anderen Aussehens, des Namens, der Sprache zur Zielscheibe rassistischer Anschläge werden könnte, sitzt den Leuten in den Knochen und muss immer aufs Neue verdrängt werden.
Auch im Alltag, im Arbeitskontext, in den Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt in sozialen Bewegungen ist die Erfahrung bzw. die Gefahr, kulturalisiert, ethnisiert, exotisiert, kriminalisiert und in vielerlei Form abgewertet und rassistisch diskriminiert zu werden, eine alltägliche Normalität. Institutionelle und strukturelle Rassismen sind an der Tagesordnung.
Sicherlich müssen wir die fachliche Auseinandersetzung über Vor- und Nachteile eines engen oder weiteren Rassismusverständnisses weiterführen. Wie alle anderen Gruppen sind auch Migrant_innen keine homogene Gruppe. Je nach Migrations- und Fluchtgeschichte, rechtlichem Status und Zugang zu Ressourcen und Leistungen, Einbindung in kollektive Strukturen u. a. m. haben sie unterschiedliche Möglichkeiten, offenen und subtilen Formen von Rassismus zu begegnen und ihre individuellen und kollektiven Strategien zu entwickeln. Das ist fast banal zu sagen, scheint aber aus dem Blick zu geraten, wenn Rassismuserfahrungen abgesprochen oder bagatellisiert werden. So wenn z. B. in Foren darüber diskutiert wird, dass Migrant_innen aus Europa nicht zu den rassistisch Diskriminierten zählen würden, weil sie weiß wären. Ihnen wird zwar zugestanden, dass sie Diskriminierungen erfahren können, aber nicht Rassismus. Wen erfasst dieses als homogen gedachte Konstrukt „Europa“ oder auch „Westeuropa“? Woher kommt dieses Bedürfnis, das Territorium abzustecken, die Angst, dass ‚Unbefugte‘ sich in die Reihen der potenziellen Opfer einschleichen würden? Und wie können Bündnisse und gemeinsame Kämpfe unter diesen Umständen gelingen?
Jeder Identitätsbegriff, jede Gruppenbezeichnung bewegt sich unvermeidlich und unauflösbar im Spannungsfeld von (Nicht‑)Repräsentation und Homogenisierung der genannten Teilgruppen und hat ein- und ausschließende Effekte. Umso wichtiger wird es deshalb, geeignete – getrennte aber auch gemeinsame – Räume zu schaffen, um darüber zu reflektieren und auch zu streiten, auch wenn die Umstände das Hinterfragen nicht gerade begünstigen.
Efthimia: Ich nehme aus Deinen wertvollen Schlaglichtern, berichteten (Miss‑)Stimmungen und dezidierten Fragen zu aktuellen Identitätspolitiken u. a. die Erkenntnis der Koexistenz von getrennten und gemeinsamen Austauschräumen mit, als eine Lern- und Möglichkeitsbedingung die Suche nach dem Gemeinsamen in der Vielheit politisch weiter in Bewegung zu halten. So würde ich gerne zum Abschluss nach Ideen, Wünschen, Perspektiven fragen.
Annita: Das Zauberwort „Bündnisse“ klingt wie ein erstrebenswertes Ziel und oft auch wie eine Sehnsucht. Mich interessiert diese Frage auch brennend, ich merke aber, dass sie oft zu abstrakt diskutiert wird.
Meine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen politischen Gruppen und Bewegungen lehrte mich, dass Bündnisse eher temporär beim gemeinsamen Tun entstehen können und nicht für immer Bestand haben müssen oder können. Ich will damit keinem unreflektierten Aktionismus das Wort reden, nur darauf aufmerksam machen, dass es eine Verständigung über den Anspruch an Bündnisse braucht. Das jeweils relevante gemeinsame Dritte zu finden, sich für die konkreten Kämpfe zu verbünden, durch das gemeinsame Tun neuen Verständigungsbedarf zu erkennen, Konflikte zu bearbeiten und Wege zu deren Klärung beim Tun hervorzubringen und dabei arbeits- und bündnisfähig zu bleiben, klingt nach einem guten Weg. Manchmal hat es geklappt, oft aber auch nicht. Scheitern ist ja Teil des Such- und Lernprozesses.
Man kann es nicht verhindern, dass die nächsten Generationen ähnliche Umwege gehen, ähnliche oder auch neue Fehler machen und manchmal unproduktive Auseinandersetzungen führen. Dennoch ginge vielleicht ein bisschen mehr an Austausch und intergenerationalem Dialog. Einige haben sich schon auf den Weg gemacht, Zugänge zum Wissen über Geschichte der Bewegungen zu ermöglichen, über Versuche von Solidarisierungen, über gelungene und gescheiterte Wege zu Bündnissen, über gemeinsam oder getrennt Erkämpftes. Die immer wieder gestellten Fragen: „Wer sind wir?“, welche Begriffe können als gemeinsames Dach dienen, welche Selbstbenennungen sind inklusiv, bleiben uns erhalten, und wenn sie eingebettet werden in die Frage: „Wo wollen wir eigentlich hin?“, finde ich meine Motivation und meinen Kampfgeist wieder.
Identitätsfindungsprozesse gehen immer einher mit Ein- und Ausschlüssen – ich bin unsicher, ob es in kapitalistischen Konkurrenzgesellschaften, in Verwertungsverhältnissen ganz anders gehen könnte. Aber zumindest ein Wissen darüber, dass nicht nur die Anderen, sondern jeweils auch die anderen Anderen verstrickt sind, und zwar nicht nur als Bekenntnis, sondern auch mit Folgen fürs Handeln, würde ein bisschen helfen. Ich könnte es ein Bewusstsein nennen über die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu denken und zu handeln.
Mein Wunsch: lernen und üben, auch in fragilen Balancen, Seiltänzerinnen zu bleiben und dabei nicht nur auf die eigenen Füße zu starren. Denn „der Blick zum Horizont, ist, rein physiologisch gesehen, eine Funktion des Gleichgewichtssinns und Bedingung der Aufrichtung“[vi].
Das Gespräch fand im Mai 2022 statt. Eine Kurzfassung des Interviews ist in einer Sonderbeilage für die taz erschienen am 18.05.2022. Das PDF zur taz-Sonderbeilage kann <hier> heruntergeladen werden.
Die Fragen stellte Efthimia Panagiotidis, Professorin an der HAW Hamburg, Anfang der 1990er-Jahre in selbstorganisierten Migrat*Innengruppen situiert, später im bundesweiten antirassistischen Netzwerk „Kanak Attak“ und in diesem Rahmen 2004 auch bei der Kampagne „Recht auf Legalisierung“ für Sans Papiers in Deutschland aktiv. Sie war 2006 in dem ersten gewerkschaftlichen Organizing-Projekt in Hamburg tätig. Von 2005–2014 organisierte sie die „euromayday-Paraden“ am 1. Mai in Hamburg, bis sie schließlich 2014 mit ihren euromayday-Mitstreiter*Innen die Genossenschaft fux eG gründete – einen selbstverwalteten Gewerbe- und Kulturort in Hamburg Altona-Altstadt – für prekäre Selbstständige aus den Bereichen Bildung, Handwerk, Kultur und Kunst, mit dem genossenschaftlichen Ziel eine Infrastruktur für kommunales Gemeinwesen bereitzustellen.
Beantwortet hat sie Annita Kalpaka, Prof. i. R. an der HAW Hamburg, in den 1980er- und 1990er-Jahren aktivistisch tätig in antirassistischen und migrantisch-feministischen Frauenbewegungen und bei dem Aufbau gemeinwesenorientierter Stadtteilzentren und Antidiskriminierungsbüros in Hamburg. Zu ihren Schwerpunkten gehören u. a. Migrations- und Rassismusforschung, Rassismustheorien, Subjekttheorien, Lerntheorien vom Subjektstandpunkt, politische Bildungsarbeit, subjektbezogene Konzepte der Erwachsenenbildung.
[i] Die Dokumentation „Wege zu Bündnissen“, die May Ayim und Nivedita Prasad 1992 erstellt haben, gibt Einblicke in die Themen und Debatten der Zeit. Dieses und weitere Dokumente sind im Offenen Archiv des Projekts Ver/sammeln antirassistischer Kämpfe im FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum zu finden.
[ii] Der gesamte Text ist zu finden unter: https://www.nadir.org/nadir/archiv/Feminismus/GenderKiller/gender_5.html.
[iii] Ein gleichnamiger Band erschien 1997: Olga Uremović/Gundula Oerter (Hsg.): Frauen zwischen Grenzen – Rassismus uns Nationalismus in der feministischen Diskussion. Frankfurt am Main 1997.
[iv] Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuzcu (2021): Migrantischer Feminismus in der Frauen:bewegung in Deutschland (1985–2000), edition assemblage.
[v] https://www.migazin.de/2021/07/15/bipoc-der-elefant-im-raum/.
[vi] Entnommen aus einem Beitrag von Reinhard Kahl: https://taz.de/Lob-des-Seiltaenzers/!1513904/.